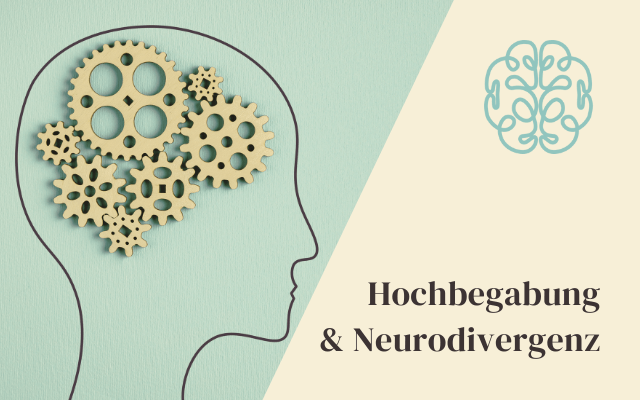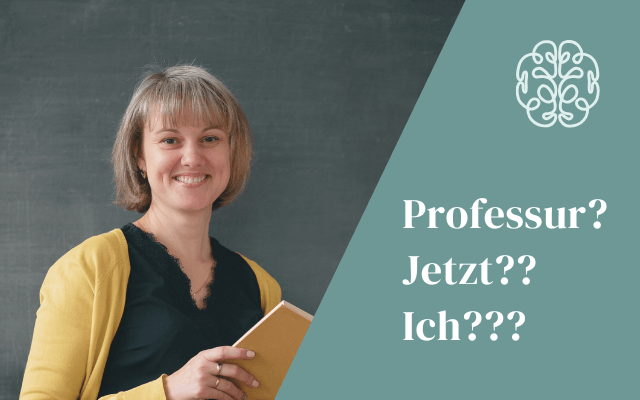Neurodivergenz und Hochbegabung erkennen bei Erwachsenen – Begriffe, die oft mit Missverständnissen behaftet sind. Was, wenn dein „Anderssein“ gar keine Schwäche, sondern eine besondere Begabung ist? In diesem Artikel teile ich meine persönliche Reise zwischen Reizüberflutung, Scanner-Persönlichkeit und dem Verdacht auf Hochbegabung. Du findest darin Orientierung, Buchtipps und Denkanstöße – vielleicht auch für dich?
Dich interessiert, was du unabhängig von der Diskussion um Begabung und Neurodivergenz immer tun kannst, um zufriedener im Job- und Lebensalltag zu sein?
Super spannend fand ich auch einen GEO-Artikel über schlaue Gehirne – mit tollen Illustrationen.
In diesem Artikel findest du
Scanner-Persönlichkeit, ADHS, Autismus, hochsensibel…neurodivergent oder einfach nur neurodivers? Was jetzt?
Meine massiv vereinfachte, nicht wissenschaftlich fundierte Einschätzung als Person mit Expertenverständnis für die Funktionsweise des Gehirns reimt sich Folgendes zusammen:
- diese ganzen Phänomene sind Teil eines Spektrums
- Zugrundeliegend ist eine „Filterstörung“.
Was meine ich damit?
Mediziner sprechen von einem Spektrum, wenn verschiedene Symptome komplex sind, überlappen, miteinander zusammenhängen, nicht genau voneinander abgrenzbar sind und teilweise fließend ineinander übergehen.
Im vorliegenden Fall haben wir also möglicherweise an einem Ende die Autismus-Spektrum-Erkrankung, die auch so genannt werden, die als nur ein Beispiel der Merkmale oftmals mit einer starken Ausprägung von Zwanghaftigkeit in Verbindung gebracht werden. Und auf der anderen Seite das ADHS-Syndrom, also Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom, was mit einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne und starkem Bewegungsdrang einhergeht (und aber auch paradoxerweise, mit der Fähigkeit zum Hyperfokus). Und klar, die Scanner-Persönlichkeiten, toll dargestellt zum Beispiel von Sarah Gierhan. Dazwischen tummeln sich irgendwo Hochbegabung und auch Hochsensibilität.
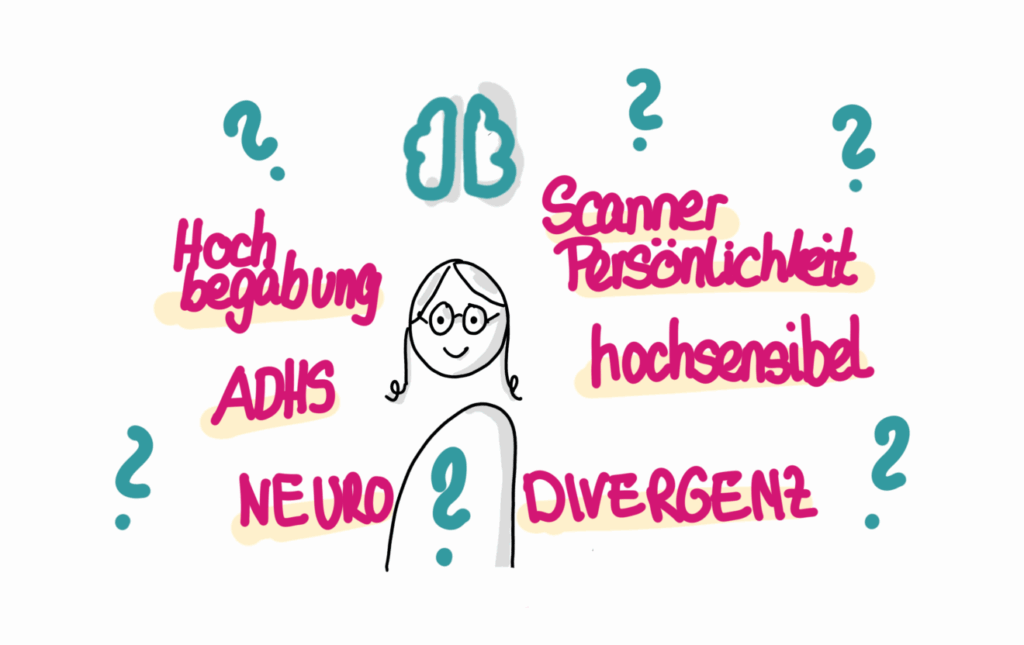
Das ist jetzt einfach nur meine Aufstellung. Das hat jetzt niemand so festgehalten. Und bestimmt gibt es 1000 Kritikpunkte ;-).
Reizüberflutung als gemeinsames Merkmal
In meiner Wahrnehmung ist all diesen Ausprägungen gemeinsam, dass sie mit einer Reizüberflutung zu kämpfen haben. Und das heißt auf neuroanatomischer Ebene, dass die entsprechenden Filterstationen im Gehirn nicht ausreichend streng filtern.
Als anatomische Strukturen wäre da in erster Linie der Thalamus – also das Tor zum Bewusstsein – zu nennen. Denn grundsätzlich ist es so, dass erstmal alle Menschen dieser Masse an Reizen ausgesetzt sind. Alle hören die Vögel zwitschern und spüren das Sofa, das Kratzetikett im Nacken, den unangenehmen Schweißduft vom Nachbarn und das aufdringliche Parfüm von der Omi nebenan – und so weiter und so fort.
Allerdings sind sehr viele Menschen in der Lage, diese Reize so weit herauszufiltern, dass viele sie nicht ober zumindest nicht bewusst wahrnehmen – und sie deshalb bei diesen Menschen glücklicherweise auch nicht zu einer Reizüberflutung führen.
Wenn jetzt eine von mir betitelte Filterstörung vorliegt, dann wird eben nicht ausreichend gefiltert und die Sinnesreize, die so wahrgenommen werden, gelangen ins Bewusstsein und haben eben die Chance, die Menschen zu überfordern – aber auch neu und kreativ verknüpft zu werden.
Diese Filter sind nicht selektiv, das heißt, wenn der Filter für ein Merkmal löchrig ist, ist es wahrscheinlich, dass auch der Filter für ein weiteres Merkmal löchrig ist: Wenn also jemand zu mir kommt und sagt „Hören Sie mal, ich glaube, ich könnte hochbegabt sein“, dann ist es für mich sehr relevant, immer auch noch eine Hochsensitivität oder Hochsensibilität mitzudenken. Und auch mit zu beraten. Ganz häufig sind die Coachees ganz erleichtert, wenn jemand nach solchen Auffälligkeiten gezielt fragt, weil sie so oft präsent sind, aber als unbedeutsam abgetan wurden.
Zudem ist es so, dass eine starke genetische Komponente vorliegt. Also: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Eltern und Kinder ähneln sich da oftmals. Für ADHS wird die genetische Komponente teilweise auf über 80% betitelt.
Einschränkungen durch Diagnostik
Jetzt kommen ein paar Einschränkungen:
Erstens: Diagnostische Tests wollen Trennschärfe erreichen. Und jetzt haben wir ja gerade verstanden, dass Trennschärfe erreichen in diesem Kontext schwierig bis unmöglich ist – oder dann eben nicht das komplette Spektrum oder auch das entsprechende Teilspektrum adäquat erfasst.
Also: Wenn eine hochbegabte Person einen Test für ADHS macht – oder auch für Autismus – dann kann sie auch noch auf Selbstaussagen hohe Werte erhalten, sodass dieser Test möglicherweise positiv ausfällt.
Hier warnt der amerikanische Psychologenverband – die APA – ganz eindrücklich: Bei Hochintelligenz davor, Diagnosen auszusprechen, zum Beispiel Autismus oder ADHS. Weil die sehr wahrscheinlich falsch-positiv sein könnten. Also die Werte – der Test sagt „Ja, du hast ADHS“, aber die Wahrheit ist: Du hast auch noch ein anderes Phänomen, nämlich Begabung. Und hast auch möglicherweise ADHS-typische Züge. Gute Panels von erfahrenen Diagnostiker:innen prüfen beispielsweise für eine ADHS Diagnostik deshalb oftmals zumindest orientierend neben klassischen ADHS Tests auch Autismus, Intelligenz und Depressivität.
Manchen Menschen kann es helfen, durch entsprechende diagnostische Pfade zu gehen und für sich mehr Sicherheit zu erlangen. Mir ist es aber wichtig, da immer diesen Disclaimer mitzudenken.
Schubladen dürfen hilfreich sein
Was ich tatsächlich hilfreich finde: In diesem ganzen Schubladen-Denken nach Konzepten zu kramen, die mir dabei helfen, einen liebevollen und freundlichen Umgang auf die Merkmale zu richten, die ich an mir als merkwürdig, als fremd, als unpassend und so weiter wahrnehme.
Und vielleicht auch einen stolzen Blick auf Kompetenzen und Vorteile durch meine spezifische Ausstattung meines Gehirns – sodass ich am Ende mir den Weg zu persönlichem Wachstum geebnet habe.
Da kann es hilfreich sein, in die Schublade Autismus zu schauen. Da kann es hilfreich sein, in die Schublade ADHS zu schauen. Aber auch in die Schublade Hochbegabung. Und auch in die Schublade Hochsensibilität.
Und dafür braucht es meines Erachtens keine Eintrittskarte.
Also: Wenn ich mit einem IQ von nur 125 oder 122 in der Schublade Hochbegabung hilfreiche Konzepte für mich selber finde – dann kann ich die doch für mich anwenden. Da muss ich doch nicht sagen: Ja, ich bin ja nur grenzbegabt, oder? Und Mensa würde mich ja nicht nehmen!
Dann ist eher die Frage: Okay, dann ist ja mein Thema Zugehörigkeit. Und dann darf ich daran arbeiten.
Hochbegabung erkennen: Biographiereihen als Einstieg
Ich bin jetzt auf dem Thema ADHS und auch Autismus nicht so bewandert und kenne auch nicht so gut Literaturempfehlungen.
Für die Hochbegabten ist es aber empfehlenswert, noch mal in die moderat Hochbegabten und in die Höchstbegabten zu unterteilen. Und gerade wenn das Thema Autismus im Raum steht, sollte – gerade bei den hoch leidenden, autismus-suspekten Personen – auch noch mal auf Hochbegabung untersucht werden. Oder auf Höchstbegabung geprüft werden.
Weil diese extrem begabten Menschen tatsächlich in unserer von normal Begabten geprägten Welt als sonderlich wahrgenommen werden.
Ein wunderschön zu lesendes Buch hat Andrea Brackmann verfasst Extrem begabt.
Hier listet sie verschiedene höchstbegabte Persönlichkeiten auf und beschreibt deren Wahrnehmung anhand von historischen Quellen und Selbstaussagen.
Und, was meinst du: Bereit, einen Blick in die Schublade Hochbegabung bei Erwachsenen zu werfen?
Um den Einstieg in das Thema Hochbegabung zu bekommen, empfehle ich Biografie-Serien. Hier gibt es zum Beispiel das Buch von Katharina Fietze: Kluge Mädchen, schlaue Frauen – oder auch das Buch von Andrea Brackmann Ganz normal hochbegabt.
In Ganz normal hochbegabt – Leben als hochbegabter Erwachsener, beschreibt Andrea Brackmann eindrücklich, wie das Phänomen des schwankenden Selbstwertes zustande kommt, von dem so viele Hochbegabte, aber auch von ADHS betroffene berichten.
Im einen Moment denkst du: Huch, was bin ich denn genial – (danke an Judith Peters an dieser Stelle für das Wortspiel „huch-begabt“). Und an der anderen Stelle denkst du: Mein Gott, wie blöd kann man eigentlich sein? Was brauchst du so lange? Hast du eigentlich Tomaten vor den Augen? Und so weiter – you name it.
In diesem Wechselspiel zwischen hochgelobt und niedergeschmettert zu leben funktioniert leider schlecht.
Andrea Brackmann beschreibt sehr eindrücklich, wie sich der Selbstwert eines jungen, heranwachsenden Menschen am Gegenüber entwickelt. Und die Validation der eigenen Leistung sehr unterschiedlich ausfällt. Dann macht ein Kind etwas sehr, sehr gut – kriegt dafür möglicherweise einen Lob – das ist jetzt erstmal der normale Weg.
Und dann schätzt man es aber alles anders ein – oder hat halt aufgrund seiner hohen Vorleistungen dann andere, nicht altersentsprechende Erwartungen an das Kind – und validiert eine Leistung als unterirdisch.
In diesem Kontext ist es eben sehr schwer, einen gleichmäßigen Selbstwert zu entwickeln.
Wer eine im Internet verfügbare Selbstbeschreibung über den schwankenden Selbstwert lesen will, wird bei Judith Peters’ Quartalsziel für das zweite Quartal 2025 fündig (der letzte)
Persönliches: Mein Weg zum Thema Hochbegabung
Ich hab tatsächlich noch nie einen Intelligenztest gemacht, um eine Hochbegabung zu erkennen. Und ich bin weiterhin noch nicht sicher, ob ich das mal machen möchte.
Ganz klar schwingt die Angst dahinter mit, eventuell doch nicht so begabt zu sein, wie ich es inzwischen gerne von mir glauben möchte. Und, was ist danach anders? Eine Frage, die ich nicht klar beantworten kann, auch nicht wenn Coachees sie fragen.
Ich war schon immer gut in der Schule gewesen. Ich war bei der Schülerakademie, bei der Chemieolympiade – war ein „Einser-Kind“ und hatte immer noch ein paar Nebenprojekte am laufen, für die ich in meinem besten Jahr für insgesamt 4 Wochen von der Schule freigestellt war. Viel spannender, als im Unterricht zu hocken 😊.
Auf die Idee, dass ich hochbegabt sein könnte, bin ich nie gekommen. Obwohl ich den Kontakt zu diesen ganzen ultraschlauen, netten, inspirierenden, super-crazy (wie ich sie mal nennen darf) Menschen unfassbar inspirierend und bereichernd fand – hatte ich selbst ja immer das Erleben, dass ich mich oft als doof und unzureichend empfunden habe. Und ein riesiges Thema mit Zugehörigkeit hatte. Und in dieser hochselektierten Gruppe auch nur völlig durchschnittlich leistete.
Erst, als ich schon im fortgeschrittenen Berufsleben das Buch von Katharina Fietze in der Stadtbibliothek entdeckte – es heimlich auslieh und erstmal mit einem Umschlag versah, damit bloß niemand sah, was ich da las – konnte ich viele „Absonderlichkeiten“, die ich an mir wahrgenommen hab und immer für merkwürdig und skurril hielt, und die in meiner Umwelt wohl als „anders sein“ galten, irgendwie begründen und in ein anderes Licht setzen. Das war schon eine Erleuchtung für mich – die mich tagelang wie auf Watte durchs Leben gehen ließ.
Das Thema ist dann aber noch mal für acht Jahre in der Versenkung verschwunden – bis mich selbst eine Coachin darauf ansprach, ob ich denn hochbegabt sein könnte. Selbstverständlich wies ich das in dem Moment brüsk zurück.
In der Praxis
Meine Kundinnen kommen oft zu mir, wenn es darum geht, neue Wege in Jobzufriedenheit zu finden. Den ganz eigenen und persönlichen Weg in Konflikten zu finden. Und sich selbst ein Leben und eine Arbeitswelt zu schaffen, die zu ihnen passt.
Dazu gehört es, mit anderen Scheinwerfern auf das eigene Erleben zu leuchten. Oftmals spreche ich das Thema Hochbegabung dann an. Wird in aller Regel brüsk zurückgewiesen – oder es kommt die Aussage: „Ja, ja, mein Sohn oder meine Tochter – eher die sind hochbegabt. Aber ich nicht. Das kommt garantiert von meinem Mann.“
Gerade in Phasen von beruflicher Neuorientierung empfehle ich gerne das Buch Kluge Köpfe, krumme Wege von Andrea Schwiebert.
Mein ganz persönliches Learning aus diesem Buch ist, dass ich im Grunde meines Herzens nicht organisationskompatibel bin. Meine Werte – Freiheit, Selbstbestimmung und Kreativität – kann ich besser in einer Selbstständigkeit ausleben. Das ist einer der Gründe, warum ich meine freiberufliche Tätigkeit so sehr feiere und genieße.
Ein weiteres Must-Read von Andrea Schwiebert: Kluge Köpfe lieben anders.
Ein wahnsinnig sensibles und tiefsinniges Buch – gerade, aber nicht nur, wenn du dich möglicherweise auch noch in den Themen der sexuellen Orientierung anders fühlst als der Durchschnitt.
Und jetzt?
Ich freu mich auf meine Reise in die Welt der Hochbegabten – jedenfalls wie Bolle – auf eine Ausbildung zur Hochbegabtenberaterin bei Frau Niehuus im Frühjahr 2026. Und bin gespannt, ob ich mich jemals zu einem Intelligenztest durchringen kann.
Bis hierhin bin ich erstmal wahnsinnig stolz auf meine Reise – dass ich das Thema selbst für mich inzwischen mit diesen Augen betrachten kann.
Wie geht es dir mit dem Thema Neurodivergenz und Hochbegabung? Bist du noch komisch oder schon stolz? Lass mich wissen, wie deine Sicht auf das Thema ist, und wenn du meine Reise weiter verfolgen willst, abonnier meinen Newsletter.
Du willst noch weiter lesen? Klicke hier für noch mehr Tipps, Tricks und Meinungen